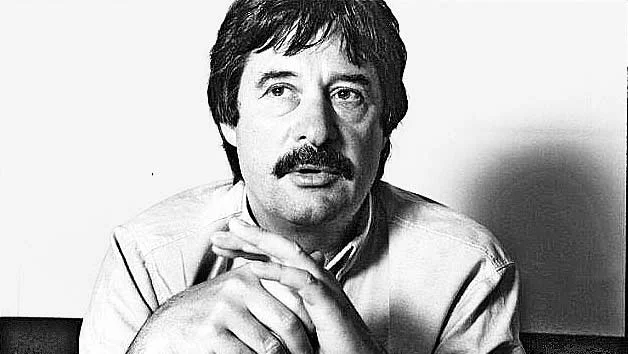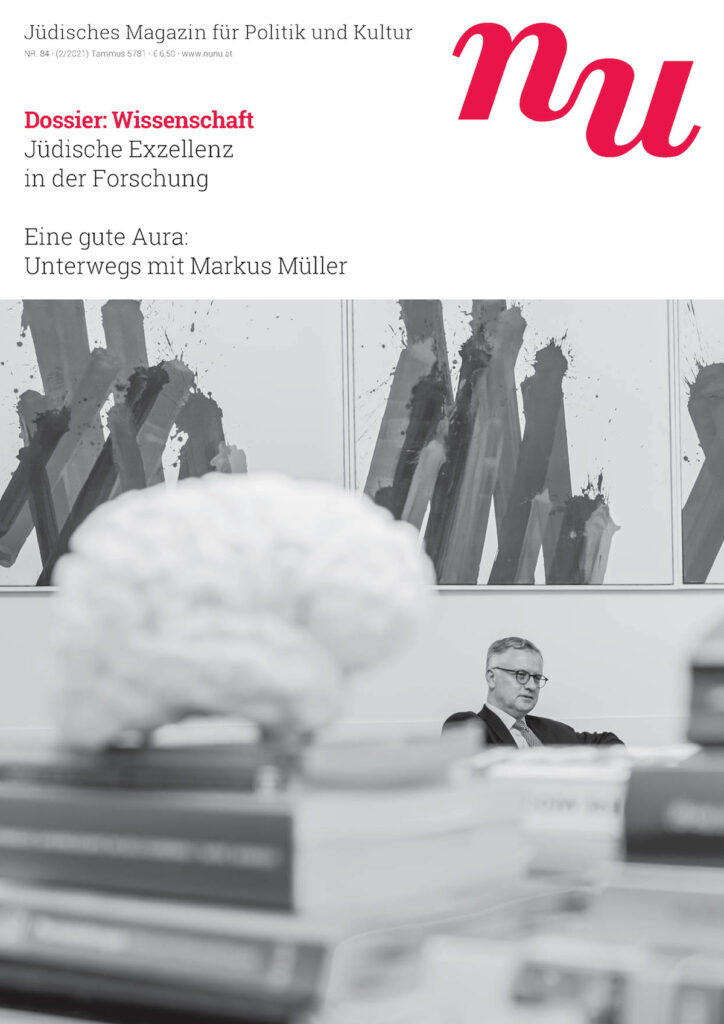Dank ihrer inzwischen 2.000 Artikel rückt Jess Wade das Wikipedia-Universum zurecht: mit Einträgen über Frauen, People of Color und anderen Minderheiten wie LGTBQ+ Personen in der Wissenschaft. 2024 ist sie Ballbotschafterin und Ehrengast am Wissenschaftsball.
Ein Porträt von Oliver Lehmann für das Ballmagazins 2024.
Eine interessante Geschichte, eine erste schnelle Recherche, ein Hinweis auf einen Wikipedia-Artikel. Im Fall von Jessica Wade führte das zu einem Eintrag1https://en.wikipedia.org/wiki/Jess_Wade über eine renommierte Materialwissenschaftlerin, die sich am Imperial College London mit der sogenannten Raman- Spektroskopie befasst, eine Methode zur Untersuchung von Materialeigenschaften etwa von Halbleitern oder Pigmenten – besonders relevant bei der Analyse von Kunstobjekten. So weit, so erwartbar. Weiterlesen